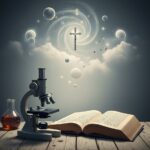Zwei Jahre nach dem Massaker und Krieg in Gaza

Photo by Jeffrey Chai on Unsplash
Was macht einen Menschen zum Menschen? Diese Frage zieht sich wie ein Leitfaden durch die Rede, aus der dieses Stück hervorgeht. „Ein Mensch wird erst zum Menschen, weil er andere Menschen wahrnimmt“ — dieses Grundgefühl von Mitgefühl, Schutz und Zugehörigkeit steht im krassen Widerspruch zu dem, was am 7. Oktober geschah und wie die Welt darauf reagierte.
Ein Blick in den Abgrund: Was der 7. Oktober offenbart hat
Der 7. Oktober ist mehr als ein Datum; er ist eine Zäsur. Das Massaker und die anschließenden Bilder haben nicht nur Leben genommen, sondern auch grundlegende Annahmen über Menschlichkeit, Moral und Schutz erschüttert. Es ging nicht nur um eine militärische Aggression, sondern um eine Schau, die zeigte, wie tief Hass über Generationen genährt werden kann — so tief, dass Töten, Verstümmeln und Vergewaltigen als Heldentat gefeiert werden können.
Doch nicht nur die Taten selbst sind entsetzlich, sondern die Reaktionen darauf: Schweigen, Verharmlosung, und in manchen Fällen offenes Feiern in europäischen Straßen. Diese Reaktionen lassen uns in einen Spiegel blicken, der mehr verrät als nur geopolitische Brüche — er zeigt moralisches Versagen.
Die Würde des Lebens und die zerbrochene Normalität
Im Mittelpunkt stehen die Menschen, deren Lebensrealitäten zerstört wurden: Opfer, Überlebende, Familien und Geiseln. Hinter dem stumpf gewordenen Wort „Geisel“ stecken einzelne Biografien — Menschen, die lachen, weinen, Pläne hatten. Zwei Jahre in dunklen Tunneln, ohne Tageslicht, ohne Gewissheit: Stunden, in denen Hoffnung und Verzweiflung im Wechsel die Oberhand gewinnen.
„Das Leben ist das kostbarste Geschenk, und es ist unsere Pflicht, es zu verteidigen — für diejenigen, die sich gerade nicht selbst verteidigen können.“
Für die Überlebenden und Angehörigen hat der 7. Oktober etwas in ihnen zerschlagen: den Glauben an ein Fundament von Gutsein und Sicherheit. Holocaust-Überlebende und ihre Kinder, die den Staat Israel ins Leben riefen, um „nie wieder“ zu erleben, wurden erneut mit einem Verlust von Vertrauen konfrontiert. Um andere zu schützen, mussten viele lernen, einen Teil von sich zu begraben — eine paradoxe, grausame Notwendigkeit.
Die Sprache der Bilder: Wie Narrativkontrolle verletzt und spaltet
Bilder können retten — oder instrumentalisieren. Hamas hat Medien- und Wirklichkeitsinszenierung genutzt: Hunger als Waffe, Geiseln als Schaubühne. Und der Rest der Welt? Wir ließen oft zu, dass Bilder die moralische Debatte ersetzten. Demonstrationen, Slogans wie „From the River to the Sea“ und die politische Rhetorik haben einen Nährboden geschaffen, auf dem einfache Narrative komplexe Lebensrealitäten überdecken.
Die Folge ist ein schmerzhafter moralischer Kurzschluss: Täter werden in Teilen der Öffentlichkeit zu Widerstandskämpfern verklärt; Opfer werden moralisierend neu interpretiert oder unsichtbar gemacht. Diese Umkehrung verletzt nicht nur die Erinnerung an die Toten, sie erschwert auch die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit.
Nicht schweigen — eine Aufforderung zum Hinschauen
Die zentrale Forderung der Rede ist klar: Weg von Gleichgültigkeit, hin zum bewussten Hinschauen. Wer wirklichseits Solidarität zeigen will, muss differenzieren zwischen legitimer Kritik an politischen Prozessen und der Verherrlichung von Mord und Entmenschlichung. Schweigen ist keine neutrale Position; es ist eine Entscheidung.
Konkrete Schritte, die jeder von uns sofort gehen kann:
- Pause einlegen: Nicht reflexartig Parolen teilen, sondern informieren.
- Informieren: Die empfohlenen Quellen ansehen — etwa Saturday-October-7.com — und Berichte, Namen und Geschichten der Opfer kennenlernen.
- Erinnern: Den Geiseln und Opfern ein Gesicht und eine Stimme geben; Namen nicht vergessen.
- Dialog suchen: Differenziert sprechen, statt sich von pauschalen Emotionen mitreißen zu lassen.
Eine persönliche Verneigung vor Überlebenden und Opfern
Am Ende bleibt die Haltung: Respekt vor denen, die weitermachen, obwohl ihnen alles genommen wurde. Die Rede schließt mit einer stillen Verneigung — vor den Familien der Ermordeten, vor den Soldaten, die kämpfen mussten, weil es keine Alternative gab, und vor jenen, die trotz Hass an der Wahrheit festhalten.
Es ist kein Appell zur Einseitigkeit, sondern ein Aufruf zur Menschlichkeit: Wenn wir als Gesellschaft bestehen wollen, dann müssen wir zeigen, dass uns Menschenleben gleich viel wert sind — unabhängig von Nationalität oder Religion. Israel braucht die Welt nicht, um zu überleben. Die Welt aber braucht die Erinnerung daran, um nicht als Menschheit zu scheitern.
Zum Nachdenken
Der 7. Oktober ist eine Prüfung — nicht nur für Israel oder Palästina, sondern für uns alle. Wir stehen vor der Frage: Lassen wir zu, dass das Mitgefühl übertönt wird von Parolen und Bildern? Oder sammeln wir den Mut, die Komplexität zu ertragen, Mitleid zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen?
Dieses Video stammt von Sarah Maria Sander und will nicht nur informieren, sondern wachrütteln. Sehen Sie es sich an, teilen Sie es, und wenn Sie wollen: informieren Sie sich weiter. Schweigen darf nicht die einfachste Antwort sein.
Autorin des Videos: Sarah Maria Sander (YouTube-Kanal: Sarah Maria Sander)